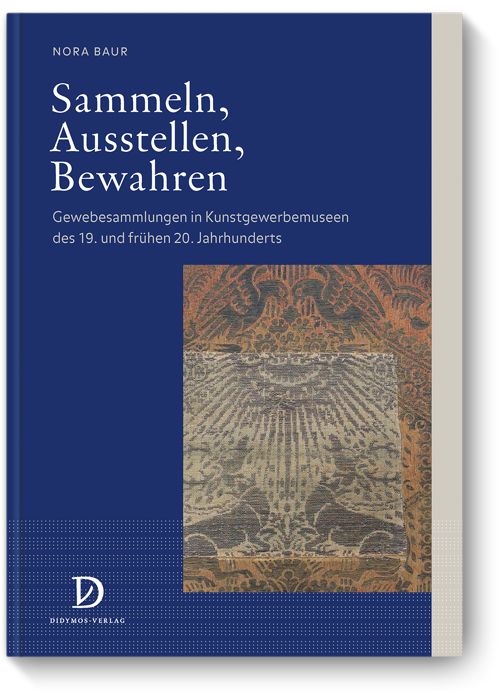Beschreibung
In den Kunstgewerbemuseen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurden die Textilbestände als herausragend wichtige Objektgruppe gewertet; besonders galt das für Tausende von kleinen und größeren Abschnitten gewebter Stoffe, die man wegen ihrer Muster schätzte. Dies kam nicht von ungefähr, denn textile Gewerbe beschäftigten im 19. Jahrhundert einen beträchtlichen Anteil der europäischen Bevölkerung, und ihr Erfolg war von immenser wirtschaftlicher Bedeutung.
Diese Studie ist der objektfokussierten Praxis der kunstgewerblichen Museen in ihrer noch wenig erforschten Frühzeit gewidmet. Ausgehend von der Konstituierung der heute marginalisierten Gewebesammlungen wird aufgezeigt, wie die Museen Methoden entwickelten, um die Bestände möglichst umfänglich zugänglich zu machen; weit mehr als heute vorstellbar sollten gerade die Textilien vom Publikum aktiv benutzt werden können. Die Kunstgewerbemuseen, die innovativen Ideen und neuen Technologien positiv gegenüberstanden, zeigten sich auch in der Entwicklung neuer Präsentationsmodi erfinderisch. Gleichzeitig waren sie ein wichtiger Motor bei der Entwicklung der Textilkonservierung und -restaurierung als neuer, professioneller Disziplin. In Ermangelung speziell ausgebildeten Personals setzte man sich an den Museen mit dem Schutz vor Lichtschäden, Methoden der Reinigung sowie mit der Prävention beziehungsweise Entfernung von Schädlingen auseinander. Erfolge und Misserfolge im Umgang mit dem fragilen Sammlungsgut waren Gegenstand eines intensiven Austauschs zwischen den Institutionen.
Autorin
Nora Baur ist ursprünglich Textilkonservatorin und -restauratorin und hat am Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern promoviert. Sie leitet das Museum Neuthal zur Textil- und Industriekultur im Zürcher Oberland.